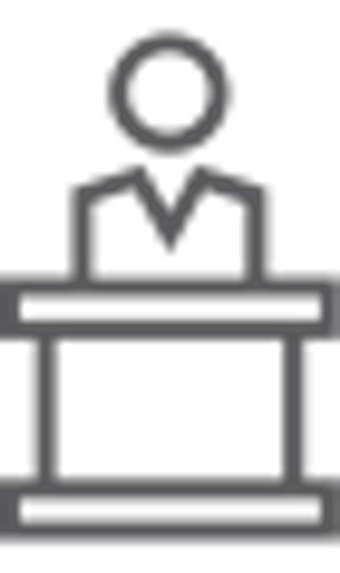Das muss euch erst einer nachmachen
Ob sie lachen? Oder sich ärgern? Die Mimik der Busfahrer kann ich nach zwei Wochen hier immer noch nicht deuten. Feststehen dürfte nur: Für sie werden Zebrastreifen auch nach dem Ende der Spiele kein Grund sein, stehen zu bleiben. Und die Freiwilligen, fiebern die dem letzten Tag entgegen? Manche sicher, vor allem jene, die jeden Tag in der Kälte oder im Wind standen. Die Mehrheit von ihnen bekam wohl keinen Bewerb zu sehen, um eben den geregelten Ablauf der olympischen Bewerbe zu garantieren. Das stellt man sich nicht prickelnd vor: Als Lohn bleibt nichts als die offizielle Olympia-Einkleidung, augenblicklich die Landesuniform in Grau-Rot sozusagen.
Und die Sportler? Wie geht es denen? Die österreichische Begeisterung, an der Schlussfeier am Sonntag teilzunehmen, hält sich jedenfalls in überschaubaren Grenzen. Vielleicht auch deshalb, weil gewöhnlich nur einer dort die Landesfahne tragen darf. Noch ist unklar, wer letztlich Flagge zeigen darf.
Losgelöst davon: Es geht heim. Auch für mich. Es wird ungewohnt sein, wenn einem an der Bushaltestelle keine Leute mehr den Weg erklären wollen. Wenn sich der Tag nicht mehr nach Medaillenentscheidungen richtet. Wenn man nicht hinter jedem Besen ein Curling-Utensil vermutet. Wenn man wieder Mut fasst, an einem Wirtshaustisch nach dem Gewürz zu greifen. Und wenn ein Tag ohne Medaille um den Hals kein Grund ist, ihn in Frage zu stellen.
Auf Wiedersehen, Korea, du schrulliges Land. Weil du die Zahl 4 fürchtest, sollen viele Krankenhäuser keinen Liftknopf für den vierten Stock haben. Unter Ventilatoren schläft keiner hier gern, weil die tödlich sein sollen. Und dass von euren 122 Athleten 35 den Namen „Kim“ tragen, 13 „Lee“ und sich neun weitere „Park“ nennen, werde ich wohl auch nicht verstehen. Verwandt sind die untereinander nämlich nicht. Ihr wart sympathische Gastgeber, eure Spiele speziell. Und das muss euch erst einmal einer nachmachen.
Manche glauben wohl, sie besuchen Disneyland
Kürzlich bewertete der Boston Globe die für Olympische Spiele typischen Nationen-Häuser. Zwei Redakteure zogen also um die Häuser, um im Anschluss über die Häuser herzuziehen. Das kann tun, wer will, allerdings nicht dann, wenn Österreich dabei leer ausgeht. Was also waren die Bewertungskriterien? Kultur? Tradition? Gold ging ans Czech House. Erklärung: Die Tschechen hätten ein bisschen von allem. Und Bier. Na aber hallo – als hätten das nicht auch andere. Silber ging an die Schweiz, die punktete mit Alphorn und Akkordeon. Gratuliere, das nächste Mal laden die Österreicher Mozart ein – reicht das für eine Medaille? Ach ja, und die Schweiz punktet mit einer riesigen Outdoor-Après-Ski-Party. Zu Gold reichte es wohl nicht, weil die Anlage nicht neben dem Ski-Stadion liege, die haben Vorstellungen. Wir sind hier nicht in Disneyland!
Okay, die Mini-Eishockey-Arena für Kinder, die kann was. Aber Abtanzen mit Skischuhen als Attraktion zu verkaufen, da geht einem buchstäblich der Schmäh aus. Bronze? Korea. Eh klar, der Veranstalter, Heimvorteil. Stolz präsentiere sich das Land (wer tut das nicht?), ein eigener Raum lädt zur Hanbok-Anprobe ein, also der landesüblichen Kleidung. Gut, klingt lustig, aber dafür Bronze herzugeben?
Nachzügler der Wertung: die Schweden mit einem Laser-Biathlon-Schießstand. Nicht gut? Wahrscheinlich trafen die beiden Journalisten nichts. Ach ja, Österreich: Deren Haus hätte eine Rodel-Schanze und Snow Volleyball zu bieten, aber das sei zu wenig. Da stellt sich die Frage, was die Herrschaften überhaupt wollen? Braucht es einen „Crying Room“, wie ihn die Holländer einmal hatten, um über Niederlagen zu weinen? Das Afrika-Haus punktete mit Flugsimulator, die Dänen mit einer Lego-Ausstellung und die Ungarn mit 16 Sorten Mineralwasser. Ist es wirklich das, was die Redakteure vom Boston Globe wollen?
Sollen sie doch zum Russland-Haus gehen. Dort, so hört man, sei die Stimmung eine durchaus betretene: Die Leute fühlen sich seit den Dopingverdächtigungen und dem Ausschluss ihrer Sportler ein wenig von der olympischen Bewegung gemobbt. Beim Besuch von Amerikanern, hinter denen man die Drahtzieher dieser Sanktionen vermutet, geht den russischen Gästen sicher das Herz auf. Durchaus möglich, dass die beiden Herren vom Boston Globe dann nicht mehr um die Häuser ziehen, sondern sich über die Häuser hauen können.
Virtuell heißt eben nicht zwingend virtuos
Sollte dieses Tagebuch irgendwann in einer Zeitkapsel auftauchen, wird man über den Inhalt Tränen der Erheiterung vergießen. Und ich glaube, nein: Ich weiß, dass das angesichts meiner hemdsärmelig verfassten Zeilen wohl heute schon einigen Lesern passiert. Technik ist meine Sache nicht.
Gestern wollte mir eine Mitarbeiterin des südkoreanischen Hauptsponsors Samsung weismachen, sie wisse, wie die Zukunft aussehe. Aber mich kann sie damit nicht locken, denn Astrologie ist mir einerlei und wir Leute mit Sternzeichen Schütze sind dafür ohnehin nicht empfänglich. Wir gelten als dynamisch, eigensinnig, inspirierend, lebensbejahend, überzeugend, weitblickend und zielstrebig. Sie sehen: Viel Schlechtes kann man unserem Sternzeichen nicht nachsagen.
Die Dame in Laborkleidung pries jedenfalls ihr Smartphone an, als habe die Zukunft bereits vorgestern begonnen und für 128 Dollar könne man auf den bereits anfahrenden Zug in ein neues Handy-Zeitalter aufspringen. Damit meinte die Gute nicht das Mobiltelefon, lediglich die Virtual-Reality-Brille, auf der es angebracht ist. Das Gerät übergestreift fühlt sich der Benutzer in einem Kinosaal, ein Joystick lässt Symbole aufpoppen und verschwinden.
Sie rät mir zu einem Autorennen, ich nicke. Sagen will ich nichts zu ihr, in meiner Welt kann sie mich wahrscheinlich gar nicht hören. Also „Super Mario“, ein Kartrennen. Schon nach wenigen Kurven überkommt einen Übelkeit, so realitätsnah nimmt sich das aus. Die Mitarbeiterin erzählt, während ich durch Zeit und Raum rase: Künftig könne man Fallschirmsprünge als Beiwagerl mitverfolgen, quasi Tandemsprung ohne Risiko. Oder Skispringen aus der Helmperspektive mitverfolgen, irgendwann sogar selbst eine neue Realität kreieren. Österreichs Athleten würden in meiner künstlichen Realität dann alle Olympiamedaillen gewinnen, aber vorstellen kann ich mir dieses Szenario derzeit nur mit technischer Hilfe: Virtuell heißt eben nicht zwingend virtuos.
Grübelnd verlasse ich den futuristischen Promotion-Stand, an dem mir eine bessere Welt verkauft wird. Vielleicht tut es einem ja wirklich nicht schlecht, die Brille der eingeschränkten eigenen Wahrnehmung abzunehmen und ins wahre Leben einzutauchen: den Journalisten, Funktionären und Sportlern dieser Olympischen Winterspiele in Pyeongchang.
Mein Busfahrer, der Cowboy
Der Bus mit der Nummer 220 ist eng, einer von der alten Dieselgeneration. Ich würde sagen: guter Abzug, lautstark im höheren Drehzahlbereich, gut bremsbar, nicht für größere Menschenansammlungen ausgelegt. Und der Fahrer: unbeirrbar und mit kräftigem Magen. Ich könnte ihn mir deshalb auch als Bobfahrer oder für ein Astronautentrainingsprogramm vorstellen – Sie wissen schon: in der Zentrifuge.
Ein wenig Cowboy steckt in ihm, kein Freund von Diskussionen. Sein Bus, seine Regeln. Viele Opfer (Fahrgäste) würden das Verhalten Rücksichtslosigkeit nennen, seine Chefs wohl Pünktlichkeit. Und die Fahrgäste sind angesichts der Fliehkräfte nicht in der Lage, sich zu wehren. Das müsste nämlich schnell passieren, irgendwo an den Haltestellen. Aber dort angekommen macht der Mittfünfziger keine Anstalten, Ältere in ihrem Tempo hinsetzen oder gar aussteigen zu lassen – er regelt das mit Gaspedal und Türöffner. Zweimal zwischen Ganeung Station und Jumunjin passierte es, dass einer seinen Arm oder Fuß für sich reklamieren musste, bevor es weiterging.
Seine Strategie: unerklärbar. Ein Beschleunigungsmanöver, wo der Grund nicht ersichtlich scheint (vorne Stau!). Und ein Bremsmanöver, wo doch eben die Haltestelle vorbeiläuft wie im Kino. Es geht sich trotzdem aus – so wie an jeder Haltestelle und zum Leidwesen der Leute ohne Sitzplatz. Nur gut, dass das Mittagessen keines war, das noch mal den Weg ans Tageslicht sucht. Es fällt ohnehin schon schwer, das Gleichgewicht zu halten, Sitzplatz Fehlanzeige. Die Skizzen mit gehbehinderten Leuten sprechen eine klare Sprache. Aber, so scheint’s zumindest: Hier dürften viele ein Gebrechen haben, selbst die jungen Leute, die mit ihren Smartphones den Älteren den Platz wegnehmen.
Der eigene Anspruch blieb es bei dieser Busfahrt, nicht ins Schwitzen zu geraten. Das ist mir zuwider und den Koreanern ganz besonders. Die Halbinsel mit einer der weltgrößten Saunadichten schwitzt oft, sieht dabei aber nicht gern zu. Und dazu passt eine Studie, die einen Gen-Unterschied zwischen Asiaten und Europäern ausmacht. Kein ausgeprägter Körpergeruch bei Koreanern, ein umso höherer bei Europäern. Wie sich also gebärden, wenn die Haltegriffe über Kopf und die anderen Busgäste in Schulterhöhe sind? Am besten gar nicht. Die Schüler, die über mich kicherten, sollten ihren Spaß haben. Bald würden sie mich vergessen haben. Und ich hoffentlich den Fahrer von Bus 220.
Spaghetti zum Frühstück
Hello darkness, my old friend! Beim Aufstehen war's heute schon wieder stockdunkel. Dabei ging beim Zubettgehen doch gerade erst die Sonne auf. The Sound of Silence begleitet mich auf dem Weg in die Arbeit. Die Straßen in Innsbruck sind leergefegt um kurz vor 1.00 Uhr in der Früh. Oder sagt man da noch 1.00 Uhr in der Nacht? Am Bahnhof torkelt mir ein einsamer Promille-Ritter auf der Suche nach einer geöffneten Bar entgegen. Slalom bei Minusgraden - das Olympia des kleinen Mannes. Auch hier hätte ein Einfädler fatale Folgen.
Angekommen im Büro, pack ich erst einmal das Frühstück aus. Es gibt Spaghetti Bolognese. Da erblasst selbst Bridget Jones vor Neid. Sie und ihre Schokolade häng ich locker um 200 Kalorien ab. Auf nüchternen Magen wohlgemerkt. Ein Grenzgang. Ein Ausloten. Ein Leben am Limit. Red ich mir zumindest ein. Ist ja sonst niemand da, dem ich das erzählen könnte.
Nach dem Morgensport (Damen-Abfahrt, Herren-Ski-Cross und Big Air) wartet ein Wurstbrot als Belohnung. In Rekordzeit fuhr Sofia Goggia zu Gold. Schneller war nur das Semmerl mit Paprika-Extrawurst und Gurkerl unten - sprich im Magen. Auch der Morgendienst - oder sagt man Nachtdienst? - biegt auf die Zielgerade ein.
Noch drei Mal steht die nächtliche Challenge in den kommenden Tagen auf dem Programm, dann erlischt endlich das Olympische Feuer. Mögen tu ich jetzt schon nicht mehr. Krankenpflegern, Polizisten, Taxifahrern und anderen Nachthacklern wird mein Sudern über die Handvoll Nightsessions nur ein müdes Lächeln entlocken. Die hätten sich für ihre 24/7-Jobs tatsächlich Gold verdient. Das ganze Jahr. Nicht nur zu Olympia.
Was aussah wie ein Haufen Nudeln, waren Aale
Immer der Nase nach, hatte ein dänischer Kollege im Bus gemeint, bevor ich am Busbahnhof von Ganeung ausstieg. Die Stunde vor dem Eisschnelllaufbewerb wollte ich dem Besuch des Jungang, des Markts, widmen. Und man glaubt nicht, um wie viel zielsicherer die Nase ist als die Navigationshilfe eines Mobiltelefons. Die Technik bietet den Weg um und sogar unter dem Bahnhof an, aber die Nase kennt nur den direkten Weg über die Gleise.
Ein wenig scheint es den wild gestikulierenden Händlern hier zu gefallen, dass westliche Gäste apathisch in die kleinen Becken voller Tentakel oder Schwimmflossen schauen, in denen träge Bewohner ihren Ozean erkannt haben. Oder hinter die Auslagescheiben, wo die Blicke der darin aufgebahrten Fische noch träger sind.
Namen für das, was sie zu Gesicht bekommen, haben Ausländer keine. Und eine Vorstellung, ob es sich nicht vielleicht doch um ein Landtier (Schlange!?)handelt, auch nicht. Beim Seeigel war ich mir nicht sicher, ob er noch lebte, der ruhte so in sich.
Am besten freundlich nicken, vielleicht die Hände falten. Für die Händler eine irdische Dankesbekundung, für unsereins eine an den da oben. Der schuf ja am vierten Tag der Schöpfung diese Prachtexemplare, die nun im mehr oder weniger lebendigen Zustand feilgeboten werden und deren Verzehr erst bei kunstvoller Zubereitung auf einem Teller vorstellbar scheint.
Entrinnen gab es scheinbar keines aus diesem Labyrinth, das zart hereinströmende Sonnenlicht ließ irgendwann doch eine Öffnung erkennen. Dort stand das vermeintlich letzte Wasserbecken. Und ich sah, zusammengeknäult wie ein Haufen Nudeln: Aale. Ich solle mir einen aussuchen, gab mir der Verkäufer zu verstehen. Einen dünnen, dicken, langen, kurzen. Ich könnte mich nicht einmal auf einen festlegen, sahen doch alle gleich aus. Auf seinem Smartphone, dessen Scheibe Spuren seiner Arbeit erkennen ließ, zeigte mir der Händler schließlich einen zubereiteten Jangeo-gui. Und aalglatt, wie man in solchen Situationen ist, nickte ich, faltete die Hände zum Dank und ging.
Haben den absoluten Tiefpunkt erreicht
Das Wunder ist also ausgeblieben. Österreichs Skispringer landeten in einem hochklassig ausgetragenen Mannschaftsbewerb nur an vierter Stelle. Und das mit dem Respektabstand von 94 Punkten auf die Medaillenränge. Es gab Zeiten, da haben die ÖSV-Adler mit ähnlichem Vorsprung gewonnen! Mannschaftlich gesehen haben die heimischen Skispringer damit den absoluten Tiefpunkt erreicht.
Wir haben ein Team, das brav und fleißig arbeitet, Innovationen finden aber woanders statt. Schon in meinem vorletzten Jahr als Trainer habe ich intern zum Thema gemacht, dass es aus dem talentierten Juniorenbereich kaum einer nach oben schafft. Doch anstatt Strukturen von Grund auf zu reformieren, hat man es damals zugelassen, dass sich jene noch mehr breitmachen, die vom Erfolg der Superadler zwar profitierten, sich aber niemals in die Verantwortung nehmen lassen würden. Damit meine ich Manager, Berater und Trainer genauso wie einige Athleten, die mit ihrer Minimalpopularität (© Toni Innauer) vollauf zufrieden sind. Aus der nordischen Abteilung ist mit breiter Unterstützung der Medien eine geschützte Werkstatt geworden – Ja-Sager sind bequemer als Querdenker.
Aus diesem Grund wird sich vermutlich auch nach den Olympischen Spielen nichts ändern, zumal nächstes Jahr die WM in Seefeld ansteht. Man hat schlechte Entscheidungen getroffen, aber niemand will sich die Blöße geben, dafür einzustehen.
Womit ich im Übrigen nicht meine Entlassung meine: Zu diesem Zeitpunkt war eine Veränderung dringend notwendig, da die Einzelinteressen über dem Teamgedanken standen. Dem ist bis heute so, wozu braucht es sonst fünf Sprungtrainer für fünf Athleten? Wenn jeder dabei sein darf, kann sich keiner beschweren. Leistungsfördernd ist dies sicherlich nicht.
Die olympische Familie umfasst eben nicht ganz alle
isweilen fällt, bisweilen stößt einem etwas auf. Ich will Ihnen deshalb nicht vorenthalten, dass meine olympische Begeisterung mitunter Schrammen bekommt. Denn so weltumspannend die Idee dieser Veranstaltung auch sein mag, ein wenig Zwei-Klassen-Gesellschaft wird dabei immer gelebt. Sportlich sowieso, da sind es manchmal sogar zwei Galaxien. Aber es verleiht der Szene ja durchaus einen sympathischen Anstrich, wenn ein Mann aus Tonga bei den Wintersportlern aufkreuzt. Manche halten dafür uns Österreicher bei Sommerspielen für so etwas wie Tonga.
Dabeisein bleibt für Zuschauer allerdings das einzige olympische Prinzip. Ein Problem nur, wenn Eisschnelllauf-Karten 500.000 Won (oder 400 Euro) kosten. Gestern traf ich Jake aus Australien und Jake aus den USA, die in China als Lehrer arbeiten und die dortige Neujahrsfeier für einen Kurzurlaub nach Südkorea nutzten. Ein Schwarzmarkt-Ticket fürs Hockey am Vorabend passte ins Budget, mehr schien nicht leistbar. Sie begaben sich dennoch zum Olympic Park in Ganeung, um Blicke auf eine südkoreanische Band und die Show eines Olympia-Sponsors zu erhaschen.
Der Zaun, an dem sie standen, hieß Endstation. Und die einzige Öffnung war der „Olympic Family“ vorbehalten, also Mitgliedern der olympischen Familie. Viele aus diesem Verbund halten das Rad dieser Veranstaltung wirklich am Laufen.
Manche davon aber drehen sich einfach nur mit, ohne viel beizutragen. Leute wie diese haben auf der „Olympic Tribune“ dennoch den besten Sitzplatz, verlassen die Wettkampfstätte über den exklusiven „Olympic Elevator“ (Lift) und steigen in extra für sie bereitgestellte „Olympic Shuttles“, wo sie als mitunter einziger Fahrgast auf der abgesperrten „Olympic Lane“ staufrei ins „Olympic Hotel“ kommen.
Vorbei an Schlangen von Leuten, die bei Minusgraden auf einen der ohnehin überfüllten Busse warteten. Jake und Jake nahmen es gestern sympathisch mit Humor: Ein Olympic Beer würde diesmal auch reichen müssen.
Wenn die Funken fliegen
Beim Gang durch die olympischen Wettkampfstätten sticht dem europäischen Beobachter ins Auge: Koreaner interessiert das Smartphone mehr als die Bewerbe. Der Blick pendelt in solchen Fällen zwischen Skispringen und dem Allerheiligsten, wobei nicht feststeht, ob denn nun das eine die Pflicht sei oder das andere. Und es erhebt sich die Frage, ob es einer App bedarf, um unfallfrei über die Straße zu kommen. Und wie sich die Leute hier denn ohne geheimnisvollen Augenaufschlag kennen lernen. Vielleicht mit einer Virtual-Reality-Brille? Sie kennen das: Sehbehelf aufgesetzt und im Lehnstuhl die Hahnenkamm-Abfahrt runterfahren.
Wie also daten und flirten Koreaner, wie finden sie zusammen? Einer Studie zufolge arbeiten sie im Schnitt 2112 Stunden/Jahr, wir Österreicher nur 1587. Das gewährt weniger Zeit für Paarung im altmodischen Sinn, also: ansprechen, Interesse bekunden, ein Getränk zahlen, tiefe Blicke und am Ende Telefonnummern austauschen.
Zeitnot und Handyliebe erklären, dass hier etwas – nennen wir es – nachgeholfen werden muss. Dass Leute ein wenig zum persönlichen Vorankommen gedrängt werden müssen – so wie das in der U-Bahn von Seoul professionelle Schubser tun, um den Waggon voll zu bekommen. Blind Dates, Gruppendates oder Heiratsvermittlungen, so ist zu lesen, tragen zum Zusammenfinden wesentlich bei. Zeit dazu haben Koreaner vom 13. Lebensjahr weg. Von da an gelten sie als ehemündig.
Romantik, so wird mir erklärt, spielt bisweilen eine geringere Rolle als das Einschreiten der Eltern. Die verschaffen sich ein Bild über die Besitzverhältnisse des jeweiligen Partners und wägen im Sinne eines Bankangestellten ab. Damit sparen sich die Paarungswilligen Make-up, eine coole Frisur und einen lockeren Spruch, die Sache kommt schließlich auch ohne ihr Zutun ins Rollen.
Auch von Sogaeting ist zu lesen, wenn nämlich Freunde als Kuppler fungieren. Doch selbst das funktioniert nicht ohne Handy: Wem es nach dem Date gefallen hat, der schickt nach der Verabschiedung eine Nachricht. Man funkt sozusagen, dass es gefunkt habe. Und der andere erwidert im besten Fall das Gefühl des Gefunkthabens. Ganz geheuer ist einem das nicht: Die Funken fliegen zwar, aber sie sprühen nicht wirklich ...
Womöglich ein (Trainer-)Rat zu viel
Dieses Mal hat wirklich nicht viel gefehlt. Auf der Großschanze schien für Michael Hayböck eine Medaille in Griffweite. In den ersten Durchgang startete der Oberösterreicher mit der richtigen Einstellung: Nicht lange darüber nachdenken, einfach drauflosspringen. Und mit einem Mal war das gute Gefühl wieder da. Als es dann wirklich um die Entscheidung ging, fiel Hayböck allerdings in alte Muster zurück: Er versuchte, seine Bewegungen zu steuern und büßte damit alles an Leichtigkeit ein, was man fürs Siegen so dringend braucht. Ich weiß nicht, ob er es besonders gut machen oder mit aller Macht dem Gefühl des ersten Durchgangs nacheifern wollte, aber eines ist klar: Um sich im entscheidenden Moment wirklich auf seine Kompetenzen verlassen zu können, braucht es ein langfristiges Konzept.
Viel war in den letzten Tagen vom Gefühl der Skispringer die Rede, das sich die ÖSV-Adler beim Spezialtraining zurückholen wollten. Doch was ist damit konkret gemeint? Der Flowzustand, in dem alles wie von selbst funktioniert? So zu denken, wäre ein fataler Fehler, denn dieser lässt sich nicht erzwingen. Wenn ich von Gefühl spreche, meine ich die Fähigkeit, den eigenen Körper so gut zu spüren, dass man absolut anpassungsfähig ist. Der Athlet muss nicht darüber nachdenken, was er zu tun hat, greift in den
Bewegungsablauf kognitiv überhaupt nicht ein. Er vertraut auf das, was er zu Genüge trainiert hat.
Nun stehen aber bei den Österreichern mittlerweile drei Trainer am Turm, begutachten jeden Flug, weitere Betreuer warten im Auslauf. Ich wette darauf, dass es keiner von ihnen geschafft hat, nach dem grandiosen ersten Durchgang nichts zu Michael Hayböck zu sagen.
Trainer sind es gewohnt, Rückmeldung zu geben, Sprünge zu analysieren und den Athleten (vermeintlich) wichtige Tipps für den entscheidenden Akt mitzuteilen. Diese Informationen zu verarbeiten, kostet aber genau jene Ressourcen, die der Athlet für den Erfolg bräuchte. Um die erträumte Medaille zu erringen, befolgt der Sportler jeden gut gemeinten Rat – und beginnt wieder nachzudenken …