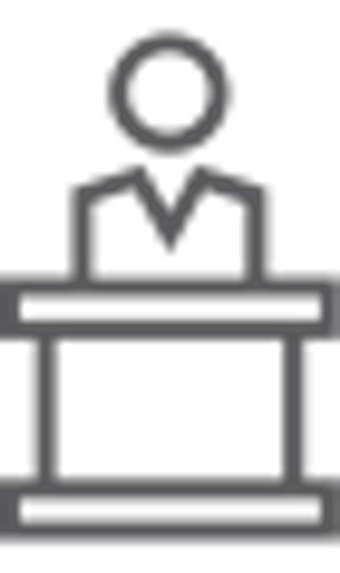Der Kraft-Code
Ein konstant Topniveau liefernder Skispringer ist ein Paradoxon. Noch jeden hat es irgendwann erwischt, zumindest vorübergehend regelrecht entzaubert, zum Schatten seines einstigen Überfliegerselbst reduziert. Die Reihe der torkelnden und manchmal endgültig „gegroundeten“ Dominatoren ist mehr als prominent: Nykänen, Ahonen, Vettori, Morgenstern, Schlierenzauer, Schmitt, Goldberger, Stoch, Kubacky, Hannawald, Prevc …
Seit mittlerweile einem Jahrzehnt ist Stefan Kraft eine verlässliche und nervenstarke Größe. Er hat Janne Ahonen als Rekordhalter bei den Weltcup-Top-3-Platzierungen überholt. Das ist wohl der aussagekräftigste Konstanz-Marker. Acht Stockerln aus Einzelbewerben bei WMs und Olympia kommen dazu.
Was macht den sympathischen Pongauer so resilient gegen all die heimtückischen Spielverderber? Ein gerüttelt Maß an Talent, Professionalität und Freude am Sport. Lernvermögen, Hingabe an die vielen unspektakulären Prozesse in der Vorbereitung. Das hatten auch andere, aber worin unterscheidet er sich?
Das Glück der späten Geburt bescherte ihm mehr Wettkämpfe und das Wind-Gate-Regulativ, das die ganz großen Ungerechtigkeiten der Branche zumindest annähernd wegfiltert. Und Stefan schafft es als einziges (außer Simon Amann an guten Tagen) der absoluten Leichtgewichte, im Anlauf konstant Spitzengeschwindigkeiten zu fahren.
Bei knappen Entscheidungen geben die Haltungsnoten den Ausschlag. Kaum vorstellbar, dass Kraft dabei den Kürzeren zieht. Weil – siehe Turnen – bei kleineren Sportler:innen Fehler schneller korrigierbar und weniger auffällig sind. Er hat auch früh genug gelernt, perfekt zu landen.
Messtechnische Details liefern winzige, aber „tragfähige“ Vorteile im Materialreglement und bevorzugen einen bestimmten Körperbautyp. Extrem leichte und weniger große Athlet:innen finden nuancierte, aber konstant mitfliegende Mikro-Vorteile bei Skibreite und Anzugweite.
Großgewachsene Athleten brauchen den optimalen Absprung. Das punktgenaue Treffen dieses Momentes – mit fast 30 Meter/Sekunde Reisegeschwindigkeit – ist nicht nur kontrolliertes Können, sondern auch Glückssache, nie wirklich kontrollierbar.
Für Top-drei-Platzierungen musste z. B. Morgenstern am Tisch voll ins Schwarze treffen. Kraft kann sich, aufgrund seiner Flugstärken, beim Absprung sogar kleine Unsauberkeiten leisten. Wenn er die Kante trifft, ist er nicht zu schlagen und sonst reicht es mitunter auch noch fürs Podest. Diese Erfahrung macht lockerer.
Und es bleibt mehr Spielraum, um die Lufthoheit wirksam zu machen, je nach Schanze, ein Zeitfenster von drei bis acht Sekunden, das bringt Kontrolle. Ausgewiesene „Abspringer“ haben dagegen nur den Wimpernschlag von 0,3 Sekunden, um ihre relativen Vorzüge auszuspielen.
Ein Champion wie Stefan Kraft schafft es, diese Nuancierungen nervenstark zu verwerten.
Sölden: Eine üppige Wintersport-Ernte
Ein Sieg von Marco Schwarz wäre der verdiente rot-weiß-rote Zuckerguss über dem Wochenende gewesen. Es war für jeden und jede etwas dabei bei diesem bunten Jahrmarkt der Aufmerksamkeit. Themen für ein ganzes Kalenderjahr drängten und konkurrenzierten sich in der dünnen Luft des Gletschers in den medialen Auslagen.
Eine norwegische Legende, der regierende Weltmeister im Slalom, möchte für Österreich an den Start gehen. Der Shootingstar aus demselben Land, Disziplinenweltcup-Titelverteidiger im Slalom, ausgestattet mit lukrativen Verträgen, gibt ohne Verletzung und echte Not mit 23 Jahren über Nacht seinen Rücktritt bekannt. Die Erklärungen des brasilianischen Norwegers Braathen sind völlig gegen den kommerziellen Mainstream gebürstet, einzigartig in der mir erinnerbaren Geschichte des professionellen Skisports. Schade um dieses Original.
Solche Vorkommnisse genügen in jeder Skination für ein emotionales Erdbeben. Dazu addiert sich die Disqualifikation von Ragnhild Mowinckel. Das überfällige Fluor-Wachs-Verbot, das Umwelt und Lungen des Servicepersonals schonen wird, hat – trotz kurzfristig um 80 % erhöhtem Grenzwert – sein erstes Opfer. Keiner konnte erklären, wie die verbotene Substanz auf den Belag kam. Die Regel aber war mit einem Schlag in aller Munde. Jeder weiß jetzt, dass ernst gemacht wird. Zweifel an der Treffsicherheit der Kontrollen lagen allerdings bedrohlich wie der sonntägliche Wetterbericht in der Luft.
Im Vorfeld wurde die Strahlkraft des Sportevents von Klimaschützern, aber auch von Ehemaligen des Sports aufgegriffen, im Sinne der Sache und wie immer auch in eigener intensiv genützt. Heftiger und breiter als je zuvor wurde über Klimawandel, den Einfluss des Skisports auf denselben und umgekehrt diskutiert.
Der Tanz auf dem dekorativ angezuckerten Vulkan führte – trotz KlimakleberInnen und nur vermeintlichem Sprechverbot für Benni Raich – nicht zur Eruption durch totale Polarisierung.
Problembewusstsein, Relativierung und Lösungsorientierung schimmerten durch. Bei AktivistInnen, die die große öffentliche Bühne – „Weltcup feiern ist kein Verbrechen, die Klima-Ignoranz der Regierung schon“– nützen wollten. Und die Ötztaler können, mit Blick auf Gurgler und Venter Ache, einordnen, dass ihnen mit einem späteren Renntermin weniger Wasser abgegraben werden wird als durch die, kurzfristig aus dem Aufmerksamkeitsfokus gedrängten, Pläne der Energiekonzerne.
Verbotenes, Umstrittenes hat eben einen magischen Reiz. Damit sichert sich der überklebte Hirscher-Ski weiterhin in bewährter Bullenmanier zusätzliche Anteile am Aufmerksamkeitskuchen. Vielleicht sind mit diesem Phänomen sogar der überraschende Zuschauerrekord am Gletscher und die hohen TV-Quoten zu erklären.
Ich bin ein Europäer, vor allem beim Ryder Cup
Skispringen und Golf haben einige Gemeinsamkeiten, beispielsweise die unerklärlichen Leistungsschwankungen der Akteure. Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman bringt es in „Schnelles Denken, langsames Denken“ (tatsächlich mit Blick auf die beiden Sportarten) auf seine Lieblingsformel:
Erfolg = Talent + Glück. Großer Erfolg = ein wenig mehr Talent + viel Glück.
Viele Wege führen nach Rom, auch zum Ryder Cup. Unsere Abordnung schaffte es über den Glückstopf beim Toni Sailer Golf Memorial mit leicht umgewichteter Kahneman-Formel.
Rom = ein wenig Talent + ziemlich viel Glück.
Während der Teambewerb im alpinen Skisport noch vergeblich um Attraktivität ringt, bleibt das kontinentale Golfduell ein ehrwürdiges und gleichzeitig elektrisierendes Sportereignis der Extraklasse. Die spezielle Stimmung auf dem Marco Simone Golfkurs vor den Toren Roms erfasste auch unsere kleine rot-weiß-rote Delegation. Unterschiedlichste Nationen, viele, wie bei der Tour de France, in kreativsten nationalen, aber auch kontinentalen Verkleidungen empfanden sich zunehmend und mit einer erstaunlichen Inbrunst als Europäer. Selbst der Umstand, dass die großen europäischen Länder wie Frankreich, Italien oder Deutschland keinen Golfer ins Team gebracht hatten, änderte nichts daran.
Österreich war mit Sepp Straka unübersehbar vertreten. Am ersten Tag erkämpfte er, Schulter an Schulter mit dem kongenial-wuchtigen Shane Lowry aus Irland, einen Punkt für Europa, gleichzeitig den ersten zählbaren österreichischen Beitrag seit Bestehen dieser Traditionsveranstaltung.
Sonntags, als Sepp am sechzehnten Green, direkt vor unseren Augen, einen Chip aus 25 Metern zum Eagle im Loch versenkte, brachen Jubelstürme in unterschiedlichsten Sprachen aus. Fans aus allen möglichen Nationen, sogar Deutsche und, über alle Gräben des Brexits hinweg, Briten, klopften uns begeistert auf die Schulter.
USA gegen Europa wirkte vor Ort auf eine unwiderstehliche Art identitätsstiftend, wie einst die Ski-Medaillen von Sailer, Hinterseer, Molterer und Co. für unser zart aufkeimendes Nationalbewusstsein.
30.000 bis 40.000 Zuseher und Zuseherinnen verteilten sich täglich, wie bei einem überdimensionalen Picknick auf dem Kurs, und zogen ruhig wieder ab. Es war „gechillt“ und gleichzeitig mitreißend. Der Sport und die Spieler standen bei diesem PGA-Event im Mittelpunkt. Der Ton auf den riesigen Leinwänden der VIP-Bereiche wurde ausgeschaltet, solange der Spielertross außen vorbeizog.
Das Konkurrenzunternehmen der PGA, die mit Saudi-Dollars zugeschüttete LIV-Tour dagegen, trommelt mit dem wenig verheißungsvollen Slogan „Golf – nur lauter“.
Erfinderschicksale im Luftstrom der Zeit
Der Schweizer Skisprungpionier Andreas Däscher ist kürzlich im 97. Lebensjahr verstorben. Seine Entdeckung, die Arme, statt sie im Flug nach vorne zu strecken, rückwärts an die Hosennaht anzulegen, revolutionierte den Sport. Der eigene Verband hatte dem 22-Jährigen die Anwendung als „regelwidrige Marotte“ verboten. Da halfen auch die Beweise aus frühen Windkanalmessungen mit Ing. Reinhard Straumann nichts. Der Verband blieb stur und Däscher ereilte das Schicksal vieler Pioniere im Sport: Die Geschichte lieferte den Beweis für die Kraft der Idee, den Erfolg und die Medaillen sahnten aber andere ab. Die Finnen erkannten das Potenzial, nannten Däschers Technik frech „Finnen-Stil“ und überrumpelten, bei den kommenden Großereignissen bis 1958, die bis dahin unantastbaren und traditionsbewussten Norweger.
Bei Messungen im Windkanal, aber zufällig, entdeckte Heinz Wosipiwo 1975 die schnellere Anfahrtshocke mit seitlich nach hinten angelegten Armen. Weil „Wosis“ Arme in Vorhalte bei den langen Messserien ermüdeten, legte er sie zum Ausrasten in der Hocke auf den Rücken. In der Sekunde fiel der Zeiger für den Luftwiderstand signifikant nach unten. Ein paar Wochen später schockte das DDR-Team die Sprungwelt bei der Skiflug-WM-75 am Kulm alle Anwesenden mit der tollkühnen neuen Hocke. Sein Teamkollege Rainer Schmidt gewann mit diesem Coup die Silbermedaille, Wosipiwo landete auf Rang sechs.
Als Jan Bokloev Mitte der Achtziger den V-Stil in die Luft zauberte, verlangte sein Trainer, dass er auf der Stelle mit diesen Verrücktheiten aufzuhören habe. Der internationale Skiverband bestrafte ihn jahrelang „wegen Regelwidrigkeit“ mit drastischen Punkteabzügen bei den Haltungsnoten. Jan sollte nie eine Medaille bei Großereignissen gewinnen. Wir Österreicher stellten 1992 (die Abzüge wurden aufgehoben) das Team auf Bokloevs V um und gewannen damit fünf von sieben möglichen Olympiamedaillen. Jan landete an 47. Stelle.
2010 in Vancouver stellte Simon Ammann die Fliegerwelt mit seiner Stab-Bindung ein weiteres Mal auf den Kopf. Er bescherte uns Österreichern die schmerzhafte Kehrseite des Erfinderschicksals. Jahre zuvor vom Erfinder Aichholzer in Kärnten entdeckt, von Sebastian Kaltenböck getestet und weiterentwickelt, wurde die Idee von uns als zu gefährlich eingestuft und (zu wenig spionagesicher) in einer Schublade versteckt.
In den Einzelbewerben holte „Simi“ zweimal Gold, uns düpierten Favoriten blieben zwei Bronzene und im Nachgang die bittere Bestätigung unserer Einschätzung, dass die Bindung das Verletzungsrisiko – wie befürchtet – empfindlich erhöht hat.
Coach the Coaches
Max Gartner war Präsident des kanadischen Skiverbandes. Mit dem Fußball aufgewachsen ist der vielseitig begabte Linzer als Skifahrer ans Schigymnasium Stams gekommen. Bei legendären Klassenmatches hat er mir so manches Tor in den Kasten gezirkelt. In den Achzigern wechselte Max wieder zum grünen Rasen und spielte u. a. mit Didi Constantini bei Wacker Innsbruck, Voest Linz und bei Bayer Uerdingen in der zweiten deutschen Bundesliga. Er studierte Sport an der Uni in Innsbruck und wanderte schließlich – wieder als Ski-Trainer – nach Kanada aus. Sein Knowhow und seine gewinnende Persönlichkeit machten ihn als Nationaltrainer erfolgreich und zum Präsidenten.
Nach dieser Rolle wurde ihm die Leitung eines bemerkenswerten Programmes übertragen. „Own the podium“ klingt amerikanisch anmaßend. Dahinter aber steckt die Idee, nicht nur Aktive, sondern auch Trainerinnen und Trainer in ihrer praktischen Arbeit und Zusammenarbeit systematisch zu unterstützen, ihr Rollen- und Aufgabenverständnis zu schärfen.
Erfahrene Experten und Mentoren stehen als Gesprächspartner, Berater und Krisenmanager in belastenden Situationen zur Verfügung. Sie bieten Unterstützung bei Lernprozessen, beim Abfedern kultureller Unterschiede, heiklen internen Entscheidungen, Auftritten in der Öffentlichkeit, aber auch persönlichem Stressmanagement an den Schnittstellen von Beruf und Privatleben. Max und seine Mitarbeitercrew agieren seit Jahren und über Spartengrenzen hinweg, egal ob Ski alpin, Frauen-Skispringen oder auch Snowboard. Erstaunliche Erfolge und Freude an der Arbeit belegen die hohe Wirksamkeit des Prozesses.
Supervision und Coaching sind in vielen fordernden Berufsgruppen Teil der Ausbildung und längst anerkannte und unverzichtbare berufsbegleitende Maßnahmen. Feedback, Mentoring und Erfahrungsaustausch kommen im therapeutischen, psychologischen, pädagogischen oder medizinischen Bereich standardisiert zum Einsatz.
In unseren Breitengraden – und besonders in psychosozial hochbelasteten Risikosportarten wie Skispringen und Ski alpin – wird die Bedeutung eines solchen Prozesses noch, bzw. wieder einmal, sträflich unterschätzt. Verbandsverantwortliche träumen nach wie vor – und nicht nur im Fußball – vom heilbringenden autonomen Wunderwuzzi, Supertrainern, „Titanen“ oder genialen Sportdirektoren.
Ehrgeizige Trainer sehen sich zu oft als entschlossen-grimmige Einzelkämpfer und verwegene Abenteurer auf der kompromisslosen Reise zu den hochdotierten Jobs an der Spitze. Auf diesem extremen Weg mangelt es an erfahrenen und vertrauten Ansprechpartnern und professioneller Begleitung für den Einzelnen. Die Entstehung einer wertvollen Sportkultur kann dabei leicht auf der Strecke bleiben.
Bevor uns die Luft ausgeht …
Fast unbemerkt ergeben sich von Zeit zu Zeit sporthistorische Momente, wie gegenwärtig bei den European Games in Krakau. Die Multisportivveranstaltung ist weder vor Ort noch medial ein Straßenfeger. Neben Traditionsdisziplinen wartet der europäische Olympiaableger aber mit Exotischem auf: Muay Thai, ein harter Kampfsport mit – für westliche Hörgewohnheiten – nerviger musikalischer Livemusikuntermalung, oder Teqball, Fußball-Pingpong an gebogenem Tisch, erweitern das Sportuniversum mit erstaunlichen motorischen Delikatessen.
Die erstmalige Durchführung von Skispringen bei einem Sommersport-Großereignis ist ein echtes sportgeschichtliches Novum. Skispringer:innen könnten also prinzipiell und sportlich vollwertig sogar bei Olympischen Sommerspielen teilnehmen? Ein Gedanke, der an dieser Stelle schon strapaziert wurde und jüngst vom norwegischen Trainer Alex Stöckl mit der Umdeutung von Skispringen vom reinen Skisport zum Abenteuersport belebt wurde. Zugegeben eine gewöhnungsbedürftige, aber frech vorausblickende Perspektive.
Das wahre Trägermedium unserer Sportart ist nicht Schnee, sondern die Luft. Luft im Sommer unterscheidet sich von jener im Winter temperaturmäßig, Konsistenz und Dichte sind verändert. Faktoren, auf die sich Skispringer:innen im Jahreslauf einstellen, ohne dass das Publikum etwas davon mitkriegt. Sollte dem Skisport irgendwann der Schnee zu knapp werden, die Luft wird unserem Sport sicher nicht so schnell ausgehen. In dieser Doppelbotschaft liegt der Anpassungsvorteil des Skispringens, das gleichzeitig zur „schnellsten olympischen Sommersportart“ ohne Motorantrieb würde.
Die spektakuläre Idee, die stillgelegte Skiflugschanze in Ironwood-USA sommertauglich zu belegen, zahlt genauso in dieses utopische Szenario ein wie all die Projekte in Dubai oder Abu Dhabi, die schon über meinen Schreibtisch wanderten.
Skispringen hat bereits im November ’22 ein bemerkenswertes Zeichen gesetzt, und das inmitten des allerorten von Schneemangel und Absagen schwer gebeutelten Skisports. Ein kostengünstiger, sportlich vollwertiger Weltcupauftakt in Wisla erfolgte pünktlich und erstmals ohne Schnee, mit Eisspur, Luft und Matte. Die globale Medien- und Sportkommerzszene hält ohnehin nicht viel von althergebrachten Gewohnheiten: Tennis und Leichtathletik finden längst auch in der Halle und zu sämtlichen Jahreszeiten statt. Seit die Fußball-WM kurz vor Weihnachten über die sandige Bühne in Katar ging, irritiert uns auch der „frühsommerliche“ Termin der Eishockey-WM mit seinem Finale Ende Mai nicht mehr.
Übertreten!
Am Tag, an dem Borussia Dortmund die deutsche Fußball-Meisterschaft vergeigen wird, sitze ich auf der Tribüne des Mösle-Stadions in Götzis. Meine Schwester und ich genießen einen Tag bunten Weltklassesport und sind Teil eines begeisterten und gleichzeitig entspannten Publikums. Neben mir sitzt Christian Schenk und versorgt uns mit exklusiven Insidereinschätzungen beim 100-m-Sprint und Weitsprung oder zur Form des Ex-Weltrekordlers Damian Warner. Christian ist in diesem Fall nicht der Unfallchirurg aus Schruns, sondern der deutsche Zehnkampf-Olympiasieger von Seoul 1988.
Im Gegensatz zum Skispringen, wo zwei Sprünge zählen, hat der Mehrkämpfer drei Versuche im Weitsprung, der beste zählt. Trotzdem hat Simon Ehammer, den ich nach seinem 8,45-m-Rekordflug vom Vorjahr unbedingt sehen wollte, einen Salto nullo fabriziert. Der Rückenwind ist heimtückischer Spielverderber auf unseren Sprungschanzen. Im leichtathletischen Anlauf bringt er eine wertvolle Geschwindigkeitserhöhung, macht aber das Treffen des Absprungbalkens unberechenbar.
Die geballte Ladung an Energie und Hochform des Schweizers sind im Anlauf und der Explosion beim Absprung regelrecht greifbar. Der zweite Versuch ist traumhaft, vermutlich über 8,30 Meter weit und auf den ersten Blick gültig.
Die Jury prüft per Video, in Superzeitlupe und zusätzlich auf dem Plastilin-Balken, ob der Sportler übertreten hat. Der Supersprung des Appenzellers erhält die rote Fahne: ungültig!
So ist die beinharte Regel, im Zehnkampf bedeutet dies den Super-GAU, man kann zusammenpacken und heimfahren. Genau das blüht dem Schweizer, der nach dem dritten Versuch, bei dem er voll ins Plastilin trat und ausrutschte. Zum Glück bleibt er bei diesem gefährlichen Fehltritt unverletzt. Als seine Kollegen mit dem Kugelstoßen loslegen, schleicht Ehammer mit seiner riesigen Sporttasche auf dem Rücken aus dem Stadion. Alle Träume vorübergehend geplatzt, die Topform weder auf den Boden noch auf die Ergebnisliste gebracht ...
Als langjähriger Regel-Optimierer im Wintersport frage ich mich, warum die moderne Technik nicht genützt wird, um Weitspringer:innen einen Puffer zu bieten und gleichzeitig die Attraktivität der Sportart zu stützen.
Der Plastilinstreifen, der schon böse Verletzungen provoziert hat, könnte durch eine trittfeste Unterlage ersetzt und zur messtechnischen Pufferzone werden: Wer davor abspringt, verschenkt Zentimeter, danach bleibt ungültig. Wer die Zehen innerhalb der Zone hat, bekommt Abzüge, die von der ohnehin vorhandenen Videomessung geliefert werden. Ehammer wäre mit vermuteten 8,29 m, hoch motiviert und zur Freude des Publikums im Zehnkampf geblieben.
Jagd auf die fette Katze
In England wurde jener symbolträchtige Tag im Jahreslauf, an dem die Topmanager so viel verdient haben wie normale Arbeitnehmer:innen im ganzen Jahr, Fat Cat Day getauft. In Deutschland ist dies der 5. Jänner, in Österreich vermutlich – und ohne Bedeutungszusammenhang – der Dreikönigstag. Chefs von Dax-Konzernen sind schon nach dreieinhalb Tagen angekommen, ein Teil davon mit Sicherheit gerade im Urlaub.
Hat das noch etwas mit Leistung oder gar mit adäquater Bezahlung zu tun? Leisten die CEOs tatsächlich um das 200-Fache mehr als normale Beschäftigte? Warum ist die Verhältnismäßigkeit in Amerika extremer als in Europa, warum sind die Skandinavier und ihre Weltkonzerne maßvoller und eher bei einem Verhältnis von 20:1 als 280:1 wie in den USA?
Was haben diese Themen und Vergleiche in einer sportnahen Kolumne zu suchen? Die Frage ist, ob es Parallelstrukturen gibt im professionalisierten Sport oder ob die Dinge im Leistungssport – nomen est omen – fairer, gerechter organisiert sind als in der globalen Wirtschaft.
Schon der Vergleich innerhalb der Sportarten lässt den Glauben daran, dass Einsatz, Anstrengung, Leistung und Erfolg immer angemessen fair belohnt werden, wanken. Das Idealmodell nationaler olympischer Komitees, in dem Goldmedaillen unabhängig von der Disziplin gleich viel Gold-Philharmoniker wert sind, kommt außerhalb der Ringe kaum zur Anwendung.
Bis Anfang der 90er und im internen Vergleich Alpin zu Skispringen wäre der besondere Tag bezeichnenderweise auf den Aschermittwoch gefallen. Die internationalen Skisprung-Einschaltquoten haben den Tag mittlerweile über das Erntedankfest hinaus in den Frühwinter geschoben! Der internationale Fat Cat Day des Sports wird kaum das verrauchte Morgengrauen des neuen Jahres erblicken. Astronomische Fußballsummen oder die mit saudischem Öl gesponserte LIV-Golf–Tour sorgen dafür. Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf…
Besondere Spannung bietet der Sport, wenn die Budget-Goliaths und Titanen wackeln, wenn Fat Cat plötzlich laufen muss wie alle anderen. Wenn Red Bull Salzburg oder Bayern München durch besondere Konstellationen sogar im eigenen Land wackeln. In der Serie A in Italien freuen sich (fast) alle über den sensationellen Meistertitel des SSC Napoli. Endlich wieder einmal hat man es den reichen Clubs im Norden gezeigt. Man hat die fetten Katzen mit dem runden Ball und großem Vergnügen über den Stiefel gescheucht.
Darin liegt der faszinierende Unterschied: Sport bleibt, allen finanziellen Absicherungen der Erfolgsarchitekten zum Trotz, doch noch ein Spiel, bei dem man auch verlieren kann.
STAMS-Dokumentation ein Weckruf
Vor 50 Jahren schaffte ich meine Aufnahmeprüfung, durfte mir den roten Schulpullover kaufen und mit Stolz überziehen. Im rechten der beiden beeindruckenden Türme der Basilika machte ich sieben Jahre später halbwegs erfolgreich die Reifeprüfung. Als „100%iger Stamser“ habe ich meine Frau dort kennen gelernt, unser Jüngster war drei Jahre lang Schigymnasiast.
Die Jahre als Lehrer, Trainer und Erzieher in Stams waren die schönsten meines Berufslebens. Als Ehemaliger bemühte ich mich, den besonderen Geist dieser Institution zeitgemäß weiterzuentwickeln. Ein Geist, der nicht vererbt wird, er muss immer wieder und in jeder Trainingsgruppe neu entfacht werden. Als „Segen der kleinen Schar“ bezeichnete Baldur Preiml die exquisite Möglichkeit, als Trainer eine ideale Gruppengröße von acht bis neun Sportlern fördern, fordern und inspirieren zu können.
Als frischer Uni-Abgänger fand ich meine Aufgabe in der individuellen Begabtenförderung. Die Talente lagen dabei nicht nur im motorischen Bereich. Mit vielen meiner damaligen Schüler bin ich immer noch in Kontakt, obwohl sie, bis auf wenige Ausnahmen, sportlich nicht an die Weltspitze kamen. Einige wie Alexander Pointner, Heinz Kuttin oder Janko Zwitter haben den Sport als Trainer geprägt. Andere sind erfolgreiche Unternehmer, Lehrer, Medienschaffende, Architekten oder Programmierer. Diese wesentliche Leistung der Schule und die Magie der vertrauensvollen Beziehungsebene zwischen SchülerInnen, Eltern, Trainern und LehrerInnen sucht man im Film vergeblich.
Es wird schonungslos auf den selbstverständlichen und verrohten Umgang mit dem omnipräsenten Verletzungsteufel hingehalten. Das ist leider ein reelles Abbild eines jahrelangen und erschreckenden Verdrängungs- und Gewöhnungsprozesses!
Viel zu kurz kommen andererseits die feinen Kraftlinien des Sports in dieser Spezialschule. Triste, nebelverhangene Bilder und monotonisierte Sequenzen haben den Sound einseitiger Sportkritik der Siebzigerjahre. Damals schon wurde Spitzensport als entfremdete und ausbeuterische Fließbandarbeit angeprangert, Leistung undifferenziert als Zwangssystem kritisiert. Damals wie heute gilt, dass man den Menschen zu vielem zwingen kann, aber niemals zu einer Weltklasseleistung. Dazu gehört nicht nur die gern zitierte Willenskraft, sondern Freiwilligkeit, Raffinesse, Mut, G’spür, Begeisterung und viel Humor.
Warum hat das Filmteam bestenfalls in der Freizeitgestaltung der SchülerInnen Restbestandteile dieser Faszination entdeckt? Waren die Akteure vor laufender Kamera doch gehemmter als gedacht oder die Trainer zu wenig überzeugt von ihrem Handwerk, um es entsprechend interessant zu machen? Oder hat sich der besondere Stamser Geist über die Jahre am Ende doch verflüchtigt?
Der Film ist jedenfalls ein Weckruf!
Crashtests
Der Skisprung-Weltcup vergangenes Wochenende in Willingen hat viele Anlässe zum Nachdenken geliefert. Der gestürzte 161,5-Meter-Sprung des Slowenen Timi Zajc übertraf alles, was ich je an überweiten Sprüngen erlebt hatte. In meinen Skisprunganfängen wäre die Weite noch Weltrekord gewesen!
Um über 160 Meter weit zu fliegen, brauchten unsere Vorgänger in Pullover und Keilhose ehrfurchterweckende 112 Stundenkilometer Anlaufgeschwindigkeit. Zajc machte den riskanten Sensationsflug aber mit nur 86,4 km/h. Es genügten durchschnittliche zwei Meter/Sekunde Aufwind, um ihn in eine Flugkurve jenseits des Kontrollierbaren zu schleudern.
Der Grund dafür ist ein physikalischer: Je langsamer ein Flugkörper unterwegs ist, desto extremer wirken sich unterschiedliche Windbedingungen aus. Düsenjets reagieren kaum auf Wind, während Paraglider unmittelbar und stark beeinflusst werden. Skispringen ist durch den V-Stil, die breiten Latten, die getunten Anzüge und das bedrohliche Leichtgewicht der SportlerInnen bis zur Unkontrollierbarkeit windabhängig geworden.
Die Japanerin Yuki Ito lieferte mit ihrem – gerodelten – 154,5 Meter-Flug das Pendant zum Slowenen. Sie demonstrierte, dass manche Frauen grandios fliegen und sogar über die Rekorde der Männer hinaussegeln können. Andererseits zeigen die nackten Zahlen, dass Ito bei ihrem Flug zwölf Luken höher als Zajc startete und immerhin 91,1 km/h dazu brauchte. Je extremer die Schanze, desto größer wird der Unterschied dieser Kenngrößen. Auf den gigantischen Flugschanzen brauchen Frauen noch viel mehr Speed als Männer. Solange sicher geflogen und ohne Sturz gelandet wird, ist alles wunderbar. Frauenskifliegen wird für Verzückung bei Zuschauern, Trainern, Vermarktern und Athletinnen sorgen.
Systematisch ausgeblendet wird das Sturzgeschehen. Nach einem wunderbaren Flug auf 128,5 m stürzte Jenny Rautionaho in Willingen unglücklich nach vorne. Neben Gesichtsverletzungen zog sie sich einen Pneumothorax zu. Ein Verletzungsmuster, an das ich mich im Herrenspringen über Jahrzehnte nicht erinnern kann – und das wohl in der unterschiedlichen Anatomie der Geschlechter begründet ist.
Zur selben Zeit machte der Beitrag „Maßstab Mann“ auf Puls 4 u. a. auch das Skifliegen für Frauen zum Thema. Mit Vehemenz wurde, auch von Aktiven und Trainern, „gleiches Recht für alle“ gefordert. Frauen würden mit substanzlosen Argumenten am Zutritt auf die größten Schanzen gehindert.
Im selben Beitrag wurde zu Recht angeprangert, dass Frauen ein um über 40 Prozent höheres Verletzungsrisiko bei Autounfällen haben als Männer. Die Dummies bei den Crashtests entsprächen dem Durchschnittsmann, nicht aber der speziellen Anatomie einer Frau. Das sei ein Sicherheitsrisiko für Frauen.
Frauen werden beim Skifliegen mit wesentlich höheren Anlaufgeschwindigkeiten als die Männer unterwegs sein und im Falle eines Sturzes sowohl mit höherer Energie als auch mit anderen körperlichen Voraussetzungen aufprallen.
Als Zuseher fragte ich mich, warum es in dem Beitrag nicht gelang, die Schlüsse aus dem Crashtestvergleich auch auf das Frauenskifliegen anzuwenden.